Burnout bei Führungskräften – typisch männliche Risikofaktoren
Führungskräfte stehen häufig unter einem hohen Leistungsdruck, der das Risiko für Burnout erheblich steigert. Dabei spielen typisch männliche Verhaltensweisen eine zentrale Rolle, die oft unbewusst zu zusätzlicher Belastung führen. Eine mangelnde Work-Life-Balance kann Erschöpfungszustände begünstigen, da Erfolg und Selbstwertgefühl oftmals ausschließlich über berufliche Ergebnisse definiert werden.
Weshalb Männer in Führungspositionen oft risikobereiter agieren, führt dazu, dass sie weniger Rücksicht auf persönliche Grenzen nehmen und Unterstützung seltener suchen. Die Tendenz zur Risikoorientierung sowie eine geringe Bereitschaft zur Reflexion verstärken die Gefahr, sich selbst zu überschätzen oder Überforderung zu riskieren. Diese Verhaltensmuster können langfristig die Gesundheit beeinträchtigen.
Übermäßiger Leistungsdruck erhöht Burnout-Risiko
Führungskräfte setzen sich häufig einem übermäßigen Leistungsdruck aus, der sich direkt auf ihr Burnout-Risiko auswirkt. Das ständige Streben nach Erfolg und Anerkennung kann dazu führen, dass sie ihre eigenen Grenzen kaum noch wahrnehmen oder ignorieren. In diesem Umfeld wird die Erwartungen an die eigene Arbeit oft zur einzigen Bewertungsgrundlage für das Selbstwertgefühl.
Wenn Erfolg zum Maßstab für den Wert einer Person wird, entstehen innere Spannungen, die langfristig erschöpfend wirken können. Dieser Druck führt dazu, dass Aufgaben häufiger übernommen werden, als tatsächlich machbar ist, wodurch Erschöpfung meist unausweichlich scheint. Zudem neigen manche Führungskräfte dazu, Risiken einzugehen, um kurzzeitig zu glänzen oder Ziele schneller zu erreichen. Das ständige Ringen darum, Erwartungen zu erfüllen, s abt die psychische Gesundheit erheblich.
Ohne eine Bewusstmachung dieser Belastungen besteht die Gefahr, in einen Teufelskreis zu geraten. Wird der Leistungsdruck nicht kontrolliert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Körper und Geist bei längerer Dauer Anzeichen von Überforderung zeigen – ein klarer Hinweis auf die drohende Gefahr eines Burnouts.
Verwandte Themen: Männer und Depression – warum so viele Diagnosen ausbleiben
Mangelnde Work-Life-Balance fördert Erschöpfung

Wenn die Work-Life-Balance leidet, wirkt sich das direkt auf die Stabilität der eigenen Energie und Gesundheit aus. Führungskräfte, die ihre beruflichen Anforderungen kaum mit privaten Aktivitäten vereinbaren können, laufen Gefahr, in einen Zustand erhöhter Erschöpfung zu geraten. Das ständige Pendeln zwischen langen Arbeitstagen und fehlender Freizeit lässt kaum Raum für Regeneration. Ohne ausreichend Auszeiten sammeln sich Stress und Anspannung an, was den Körper und den Geist belastet.
In solchen Situationen übernehmen viele Führungspersönlichkeiten nur noch Aufgaben im Beruf, wodurch persönliche Interessen häufig vernachlässigt werden. Der Fokus liegt ausschließlich auf Erfolg und Zielerreichung, auf Kosten eigener Wohlbefinden und sozialer Beziehungen. Die permanente Präsenz im Job fördert eine Einstellung, bei der die eigene Zufriedenheit zurücktreten muss. Es entsteht eine Dynamik, in der Erschöpfung frühzeitig auftreten kann, denn die Energiereserven werden kontinuierlich angegriffen. Langfristig führt diese Unausgewogenheit dazu, dass körperliche und psychische Reserven allmählich aufgebraucht werden, was letztlich das Risiko für ein Burnout deutlich erhöht.
Wer seine Grenzen nicht rechtzeitig erkennt oder ignoriert, setzt sich selbst einem erheblichen Belastungsdruck aus. Das Fehlen von Ausgleichsmaßnahmen vermindert die Fähigkeit, Erholung zu finden. Das Resultat ist eine Abwärtsspirale, in der Energieverlust und mentale Erschöpfung Hand in Hand gehen – ein Zustand, der unbedingt vermieden werden sollte. Daher gilt es, gezielt Zeiten für Entspannung und private Aktivitäten festzulegen, um längerfristig stabil und leistungsfähig zu bleiben.
Selbstwertgefühl durch Erfolg bestimmt
Für Führungskräfte ist das Selbstwertgefühl häufig stark an beruflichen Erfolgen verknüpft. Das bedeutet, dass der persönliche Wert oft nur dann als hoch empfunden wird, wenn bestimmte Ziele erreicht wurden oder Anerkennung durch Kollegen und Vorgesetzte vorhanden ist. Diese Abhängigkeit kann dazu führen, dass Erfolg zum Maßstab für die eigene Identität wird, wodurch eine dauerhafte Bestätigung im Außen erfolgt. Werden diese Erfolge nicht erzielt, droht ein Gefühl der Unsicherheit oder des Zweifelns an der eigenen Person.
In solchen Situationen neigen viele dazu, sich ausschließlich auf die berufliche Leistung zu konzentrieren und andere Aspekte wie persönliche Gesundheit oder soziale Beziehungen in den Hintergrund zu stellen. Dieser Fokus auf externe Validation kann kurzfristig motivierend sein, führt aber langfristig dazu, dass innere Zufriedenheit nur schwerlich aufrechterhalten werden kann, ohne vorherige Erfolgserlebnisse. Das ständige Streben nach Bestätigung durch Arbeitsschritte sorgt dafür, dass das Selbstbild linear mit dem Erfolg wächst oder sinkt.
Wenn diese Verbindung jedoch allzu eng wird, besteht die Gefahr, das eigene Wertempfinden übermäßig an äußeren Faktoren zu hängen. Dies erhöht die Verletzbarkeit gegenüber Misserfolgen und kann bei wiederholter Nichterfüllung zu einem tiefgreifenden Gefühl der Unzulänglichkeit führen. Um psychische Belastungen vorzubeugen, ist es ratsam, auch andere Quellen des Selbstwerts zu nutzen und gerade die eigene Persönlichkeit jenseits des beruflichen Umfelds wertzuschätzen.
Vernachlässigung eigener Bedürfnisse häufige Ursache
Viele Führungskräfte neigen dazu, ihre eigenen Wahrnehmungen und emotionale Balance zu vernachlässigen, wenn sie in einer anspruchsvollen Arbeitsumgebung agieren. Das ständige Bestreben nach Erfolg und Anerkennung führt häufig dazu, dass die persönlichen Grenzen in den Hintergrund treten und die Aufmerksamkeit vor allem auf berufliche Zielsetzungen gerichtet wird. Dieses Verhalten kann dazu führen, dass das eigene Wohlergehen auf der Strecke bleibt.
Wenn man sich ausschließlich auf äußere Erfolge konzentriert, verdrängt man oft die Signale des Körpers oder Geistes, die auf eine Überforderung hinweisen. Die Folge ist, dass Anzeichen von Erschöpfung oder innerer Unruhe ignoriert werden. In solchen Fällen werden die eigenen Ressourcen systematisch überschätzt, wodurch langfristig das Risiko für eine mentale oder physische Erschöpfung steigt. Das Vernachlässigen eigener Bedürfnisse ist somit ein häufiger Startpunkt für das Entstehen eines Burnouts.
Immer wieder fällt auf, dass viele Führungspersonen Aufgaben bis zum Punkt der Überlastung übernehmen, weil sie Schwierigkeiten haben, „Nein“ zu sagen oder ihre Prioritäten klarzulegen. Diese Einstellung kann schnell zu einem Zustand führen, bei dem persönliche Regenerationsphasen fehlen. Der Fokus auf den eigenen Wohlfühlzustand tritt dadurch in den Hintergrund, was sich schlussendlich negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann. Sich selbst gegenüber mehr Achtsamkeit zu entwickeln und gezielt auf die eigenen Signale zu achten, ist daher zentral, um einer chronischen Überforderung vorzubeugen.
Verwandte Themen: Viagra und Co. – Lifestyle-Medikament oder medizinische Notwendigkeit?
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkung auf Burnout |
|---|---|---|
| Übermäßiger Leistungsdruck | Ständiges Streben nach Erfolg und Anerkennung, Grenzüberziehung | Höhere Erschöpfung, erhöhtes Burnout-Risiko |
| Mangelnde Work-Life-Balance | Verminderte private Erholungszeiten, Überarbeitung | Erschöpfung, regenerationsarmes Umfeld |
| Selbstwert durch Erfolg | Abhängigkeit vom beruflichen Erfolg für das Selbstwertgefühl | Unsicherheiten bei Misserfolgen, emotionaler Stress |
| Vernachlässigung eigener Bedürfnisse | Fokus auf externe Erwartungen, Missachtung eigener Grenzen | Mentale und physische Erschöpfung |
| Risikoaufnahme | Höhere Bereitschaft, Risiko einzugehen, ohne persönliche Grenzen zu reflektieren | Gefahr der Überforderung, Burnout |
Wettkampfstärke führt zu Überforderung
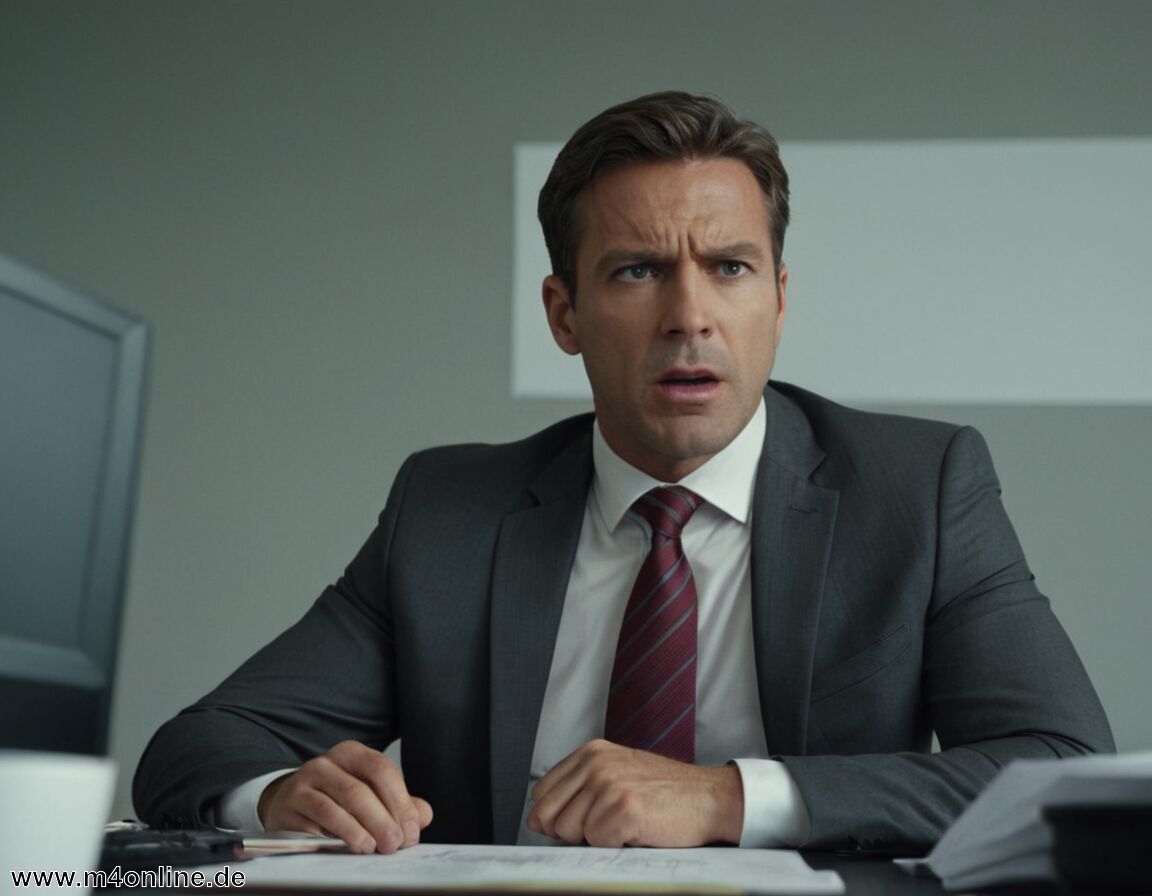
Viele Führungskräfte zeichnen sich durch eine ausgeprägte Wettkampfstärke aus, die sie motiviert, ständig an ihre Grenzen zu gehen. Dieser Antrieb ist zwar oft mit Erfolg verbunden, birgt aber auch das Risiko der Überforderung. Wenn der Wunsch nach Anerkennung und Sieg überwiegt, neigen manche dazu, Aufgaben ohne Rücksicht auf ihre eigenen körperlichen oder mentalen Reserven zu übernehmen. Das ständige Streben, in jedem Bereich vorne zu sein, führt dazu, dass sie kaum Pausen einlegen und den Blick für die eigenen Grenzen verlieren.
Die Tendenz, stets einen Schritt voraus sein zu wollen, kann bei längerfristiger Betrachtung belastend wirken. Die überschüssige Energie, die in diesem Wettkampf-Modus freigesetzt wird, sorgt zwar kurzfristig für hohe Produktivität, doch droht langfristig die Bleikmütze einzusetzen. Ohne bewusste Regeneration steigt die Gefahr, an einem Punkt der Erschöpfung anzukommen. Auch das Gefühl, nur noch im Wettbewerb zu stehen, erschwert es, Situationen objektiv wahrzunehmen und rechtzeitig gegenzusteuern.
Es ist wichtig, das Maß zu finden zwischen gesunder Wettbewerbsfähigkeit und dem Schutz eigener Ressourcen. Wer seine Aktivität unreflektiert bis zum Äußersten treibt, läuft Gefahr, sich selbst zu verlieren. Ein dauerhaftes Hochhalten eines solchen Level kann dazu führen, dass allmählich die Energie schwindet, was sich letztlich in physischen und psychischen Beschwerden niederschlägt. Daher lohnt es sich, regelmäßig innezuhalten und den Blick auch auf die eigenen Grenzen zu richten, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.
Lesetipp: Erektionsstörungen als Frühwarnsignal für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Wenig Unterstützung durch Peers oder Team

Viele Führungskräfte neigen dazu, sich auf ihre eigenen Kapazitäten zu verlassen und schenken der Unterstützung durch andere nur wenig Beachtung. Wenig Austausch mit Peers oder Teammitgliedern kann ein großes Risiko für die psychische Gesundheit darstellen, da dadurch eine wichtige Ressource zur Bewältigung von Stress entfällt. Gerade in Situationen hoher Belastung ist es hilfreich, auf Rückhalt aus vertrauten Kreisen zurückgreifen zu können, um Erfahrungen zu teilen und neue Perspektiven zu gewinnen.
Fehlt dieser Austausch, entsteht häufig das Gefühl, allein mit den Problemen zu sein. Besonders diejenigen, die ihre eigene Leistung stark über die Anerkennung anderer definieren, ziehen sich bei Schwierigkeiten eher zurück, anstatt aktiv nach Unterstützung zu suchen. Dieses Verhalten fördert die Isolation, was die Gefahr erhöht, dass Gefühle von Unsicherheit oder Überforderung verstärkt werden.
Ein unterstützendes Umfeld, sei es innerhalb des Teams oder im erweiterten Netzwerk, bietet oft die Möglichkeit, Konflikte zu lösen oder Konflikte frühzeitig zu erkennen. Ohne diese soziale Absicherung steigen die Chancen auf Erschöpfung deutlich an. Es ist daher ratsam, offen für den Austausch mit anderen zu bleiben, um Belastungen besser regulieren zu können. Das stärkt nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern verhindert langfristig das Entstehen eines Burnouts bei Führungspersonen.
| Risikofaktor | Verhaltensmuster | Konsequenzen für die Gesundheit |
|---|---|---|
| Wettkampfstärke | Ständiger Antrieb, möglichst immer vorne zu sein, kaum Pausen | Erhöhte Erschöpfung, Burnout-Gefahr |
| Geringe Reflexion | Beobachtet persönliche Grenzen kaum, handelt impulsiv | Gefahr der Überforderung, mentale Belastung |
| Poor Unterstützung im Netzwerk | Vermeidet Austausch mit Kollegen und Team | Isolation, erhöhtes Risiko für Erschöpfung |
Höhere Tendenz zu Risikoaufnahme
Viele Führungskräfte zeigen eine ausgeprägte Höhere Tendenz zu Risikoaufnahme, was sich vor allem durch die Bereitschaft auszeichnet, unvorsichtig oder impulsiv Entscheidungen zu treffen. Dabei ist diese Eigenschaft oftmals mit dem Wunsch verbunden, sich im Wettbewerb hervorzuheben und Erfolg sichtbar zu machen. Diese Risikobereitschaft kann kurzfristig Vorteile bringen, doch bei mangelnder Kontrolle steigen die Schwierigkeiten im Umgang mit unerwarteten Situationen.
Verschiedene typische Verhaltensmuster verdeutlichen das Problem: Es wird häufig die eigene Einschätzung überschätzt, wodurch Grenzen weniger beachtet werden. Das führt dazu, dass Risiken eingegangen werden, ohne die eventuellen Konsequenzen vollständig abzuschätzen. Das Gefühl, immer vorne mit dabei sein zu müssen, resultiert in einem Hang, Grenzwerte zu ignorieren – sei es in Bezug auf Zeit, persönliche Belastbarkeit oder finanzielle Ressourcen.
Der Drang nach Erfolg verleitet dazu, auch in unsicheren Situationen schnelle Entscheidungen zu treffen, manchmal ohne hinreichende Reflexion. Diese Stimmung einer dauerhaften Wachsamkeit fördert das Übersehen wichtiger Warnzeichen, welche aufklingen, wenn man zu impulsiv handelt. Das dauerhafte Einlassen auf riskante Vorhaben ohne ausreichendes Abwägen kann die Fähigkeit beeinträchtigen, langfristige Stabilität zu wahren. Letztlich besteht die Gefahr, in eine Spirale der Überforderung zu geraten, die bei längerer Dauer den Betroffenen an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bringt.
Wenig Reflexion über persönliche Grenzen
Viele Führungspersönlichkeiten neigen dazu, ihre eigene Grenzen zu ignorieren oder nur unzureichend zu reflektieren. Sie setzen oft alles auf eine Karte, um berufliche Ziele zu erreichen, ohne die Signale ihres Körpers oder Geistes ausreichend wahrzunehmen. Diese Unachtsamkeit kann dazu führen, dass erste Anzeichen von Erschöpfung oder innerer Unruhe nicht rechtzeitig erkannt werden.
Das ständige Bestreben, im Job alles perfekt zu machen, trägt dazu bei, dass eigene Ressourcen systematisch überschätzt werden. Das führt dazu, dass man sich schnell in Situationen wiederfindet, in denen man an seine physischen oder mentalen Grenzen stößt. Häufig wird dann erst spät bewusst, wie stark die Belastung bereits ist, was die Situation verschärfen kann. Ohne regelmäßige Reflexion besteht die Gefahr, den eigenen Zustand dauerhaft zu vernachlässigen und wichtige Alarmzeichen unbeachtet zu lassen.
Ein Mangel an Achtsamkeit gegenüber den eigenen Grenzen fördert das Risiko der Überforderung erheblich. Dies zeigt sich häufig darin, dass man trotz deutlicher Zeichen von Erschöpfung weitermacht, weil das Gefühl vorherrscht, keine Alternative zu haben. Es ist daher notwendig, bewusster hinzusehen, wann die Energie nachlässt, und aktiv Pausen einzubauen. Andernfalls steigt die Gefahr, langfristig in einen Zustand der mentalen und physischen Überlastung abzurutschen – ein Narrativ, das es gilt, frühzeitig zu durchbrechen.
Belegstellen:

